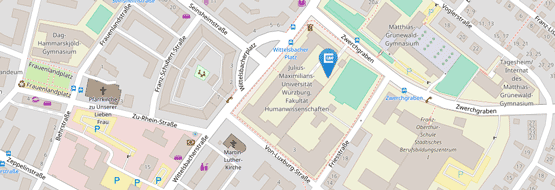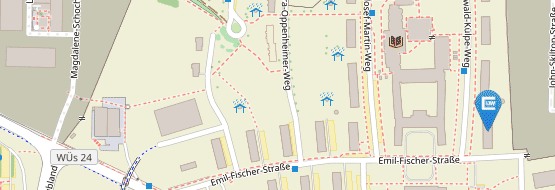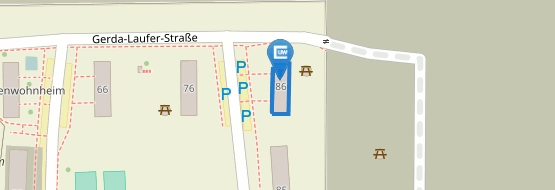Schulwandbilder - Geschichte und Forschung
Die Geschichte der Schulwandbilder beginnt im späten 18. Jahrhundert und ist eng mit der Entwicklung der Schulbuchillustration verknüpft. Bereits 1776 wurden im Dessauer Philanthropin großformatige Bilder aus Basedows Elementarwerk im Unterricht eingesetzt. Mit der Erfindung der Lithographie um 1800 wurde ihre Produktion in großem Maß möglich und finanzierbar. Bald entstanden erste speziell für den Unterricht konzipierte Serien, etwa die Methodische Bildertafeln (1837) von Reimer und Wilke.
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etablieren sich Schulwandbilder als eigenständige didaktische Medien neben dem Schulbuch. Für jedes Schulfach – von Religion bis Turnen – wurden umfangreiche Bildserien entwickelt. Sie dienten nicht nur der Veranschaulichung, sondern prägten die schulische Sozialisation und die Vorstellungswelt ganzer Generationen. Erst mit dem Aufkommen neuer Projektionstechniken in den 1960er Jahren trat das Schulwandbild zunehmend in den Hintergrund.
Forschungsrelevanz: Zwischen Quelle, Medium und Botschaft
Schulwandbilder galten lange als randständige Objekte der Forschung. Erst mit dem bildungshistorischen Perspektivwechsel hin zur Sozial- und Kulturgeschichte wurde ihr Quellenwert erkannt. Als zentrale Unterrichtsmedien über mehr als ein Jahrhundert spiegeln sie nicht nur pädagogische Konzepte, sondern auch gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen und politische Ideologien ihrer Zeit.
Im Kontext bildungsphilosophischer Fragestellungen erscheinen Schulwandbilder als symbolische Ordnungen einer „Politik der Bilder“. Sie konstruierten historische Narrative, nationale Identität und kulturelle Selbstbilder – und machten über Bildräume normative Wirklichkeitsentwürfe sichtbar.
Auch kulturgeschichtlich sind sie aufschlussreiche Zeugnisse: In Bildinhalten und Gestaltungsformen manifestieren sich dominante Stereotype, Normen und emotionale Kodierungen. Kunsthistorisch belegen sie Tendenzen der Alltagsästhetik und der schulischen Geschmacksbildung, während sie medienpädagogisch Einblicke in historische Visualisierungsstrategien geben – und als Vorläufer der Infografik und heutiger "visual literacy"-Konzepte gelesen werden können.