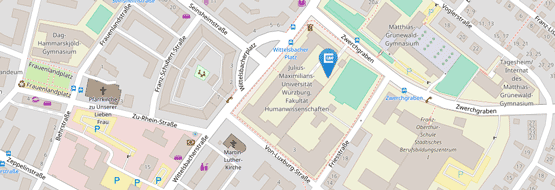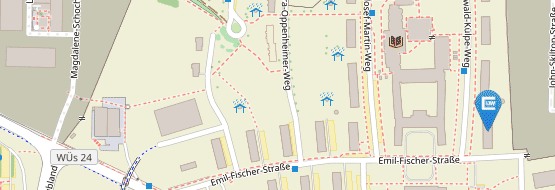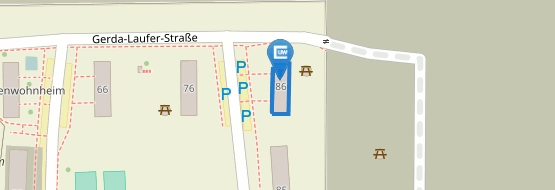Aufgaben und Projekte
Zu den Aufgaben, Aktivitäten der Forschungsstelle Historische Bildmedien zählen
- die Erforschung historischer Bildmedien
- die Durchführung drittmittelrelevanter Forschungsprojekte auf nationaler und internationaler Ebene (siehe Projekte)
- die Aufbereitung von Bild- und Textdaten, Bereitstellung von Bildern für Forschungs- und Ausstellungszwecke (z.B. kultur-, kunst- und medienhistorische Forschungseinrichtungen, Museen)
- die Förderung von Forschung und Lehre; Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten; Begleitung von Promotionsvorhaben
- die fortlaufende Ergänzung und Erweiterung des Bild- und Literaturbestandes
- der Ausbau archivpädagogischer Angebote